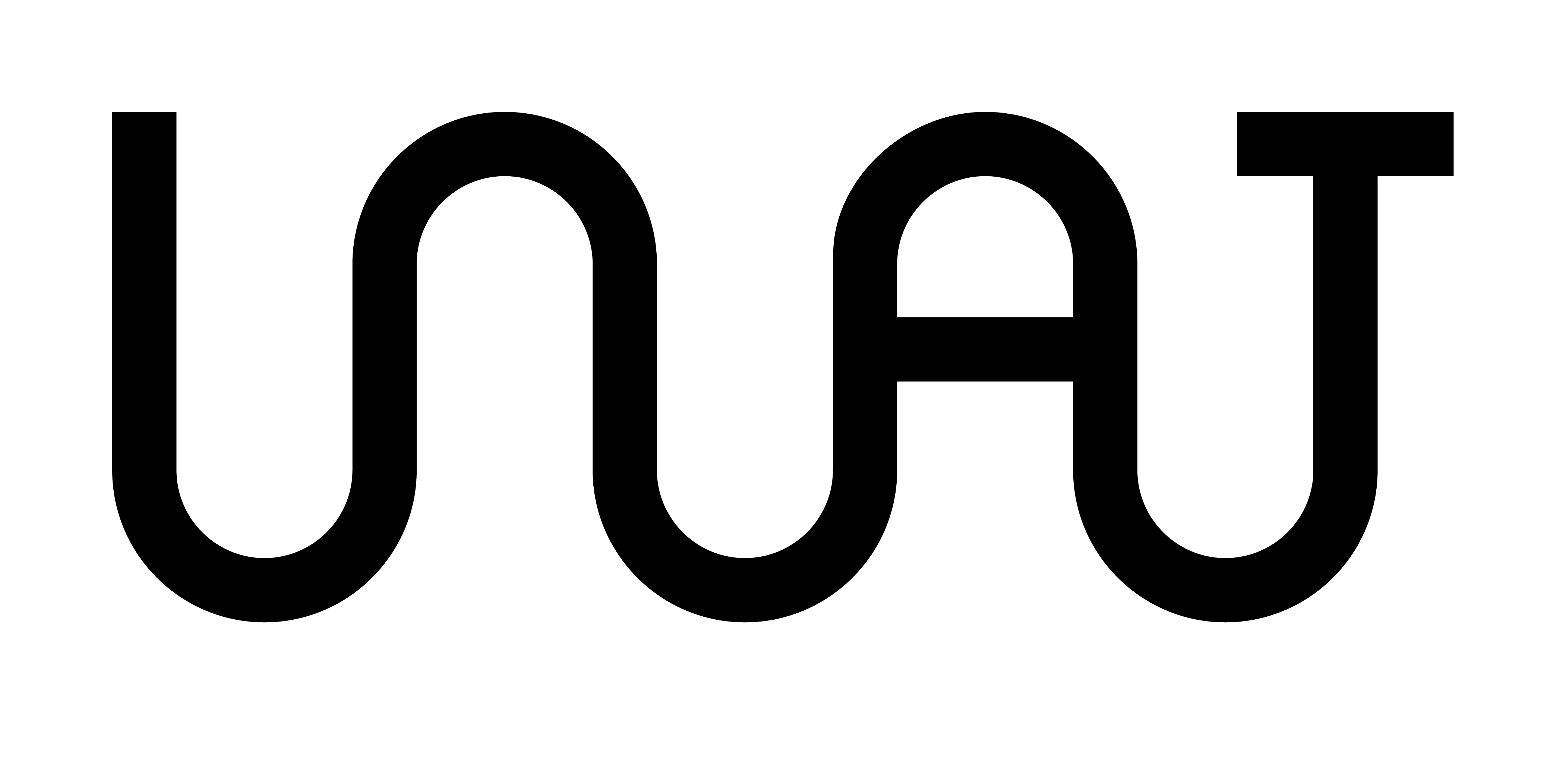Handlungsempfehlungen für politische Medienbildung im Kontext von Demokratien im Wandel
Die folgenden Handlungsempfehlungen sind im Rahmen des praxisorientierten Forschungsprojekts „Unlearning Anti-Feminism on TikTok“ (UlAT) entstanden, das vom 01.06.2024 bis zum 31.05.2025 von der Universität zu Köln und mediale pfade e.V. durchgeführt und von der VolkswagenStiftung in der Förderlinie „Transformationswissen über Demokratien im Wandel“ gefördert wurde. Sie richten sich in erster Linie an Lehrende und Bildner*innen in verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern; sie können aber auch Eltern, Bezugspersonen sowie Jugendlichen und jungen Erwachsenen Orientierung bieten. Um ergänzend zu diesen Empfehlungen verständliche Definitionen für wichtige Begriffe im Bereich der politischen Medienbildung bereitzustellen, wurde im Rahmen des Projekts ein Glossar erstellt, welches über die Projektwebsite (antiantifeminism.org) zugänglich ist.
Medien- und Gesellschaftsanalyse
1. Entschleunigung der Wahrnehmung
Auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen erscheinen die Inhalte in rasanter Geschwindigkeit, was ein Verstehen und Einordnen der transportierten Botschaften sowie deren Refl exion erschwert. Außerdem werden Inhalte von (insbesondere antifeministischen) Akteur*innen stark emotionalisiert dargeboten. Für die politische Medienbildung ist es daher wichtig, mit dem Ziel einer Entschleunigung der Wahrnehmung, einen verlangsamten Blick auf die vielschichtigen Posts, ihre Bedeutungsebenen und dadurch ausgelösten Emotionen zu fördern. Hierzu eignen sich Methoden der kritischen Medien- und Gesellschaftsanalyse, die eine Re- und Dekonstruktion von Bedeutungen ermöglichen. Um verschiedene Perspektiven auf die wahrgenommenen Inhalte miteinander in den Diskurs zu bringen und diese entsprechend einzuordnen, bietet es sich an, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Gruppen arbeiten zu lassen.
2. Sensibilisierung für Erkennungsmerkmale
Antifeministische (und andere politische) Botschaften erscheinen auf TikTok in gewissen Ästhetiken und Codes, die größtenteils gezielt eingesetzt werden. So nutzen beispielsweise viele sogenannte Tradwives audio-visuelle Ästhetiken der 50er Jahre, um den vorgelebten Lebensstil zu romantisieren. Solche Codierungen und Ästhetiken erkennen und einordnen zu können, sollte ein wichtiges Ziel politischer Medienbildung sein. Hierbei gilt es, für die Verschleierung von Begriffen und Botschaften zu sensibilisieren. Der geschulte Blick muss sich dabei unweigerlich auf die verschiedenen Elemente auf Social-Media-Plattformen (Bilder, Videos, Texte, Musik, Hashtags, Likes, Kommentare) richten sowie die Verschränkungen der verschiedenen Plattformen mitdenken. So sind Inhalte auf TikTok nicht losgelöst von solchen auf beispielsweise Instagram oder Snapchat zu sehen.
Entwicklung von Handlungsstrategien
3. Verstehen und Nutzen von Plattformmechanismen
Über die Förderung von analytischen Fähigkeiten hinaus ist die gemeinsame Entwicklung von Handlungsstrategien eine wichtige Aufgabe politischer Medienbildung. Da Social-Media-Plattformen wie TikTok auf Algorithmen basieren, gilt es hierbei zunächst aufzuzeigen, wie man Algorithmen aktiv beeinflussen kann, um unerwünschte Inhalte zu reduzieren. Dies setzt auch voraus, dass ein kritisches Verständnis für die herrschende Aufmerksamkeitsökonomie entwickelt wird. User*innen müssen also um die möglichen Einflüsse von Interaktionen mit Posts (wie Kommentieren, Liken, Teilen, Speichern usw.) auf die weitere Verbreitung problematischer Inhalte wissen. Das Kennen und Nutzen von Melde- und Blockierfunktionen bei der Identifi kation von problematischen Inhalten und Accounts gehört hier ebenfalls zu. Es sollte einerseits gemeinsam geübt werden, solche Strategien anzuwenden und andererseits besprochen werden, wann die Nutzung der Funktionen sinnvoll ist und wo die Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten liegen. Wie in allen Bereichen politischer Medienbildung ist es auch hier notwendig, das unterschiedliche Vorwissen der Zielgruppen zu beachten. So werden mit Sicherheit viele junge TikTok-Nutzer*innen um die Plattformmechanismen wissen, jedoch nicht alle.
4. Entwicklung von Diskursstrategien
Social-Media-Plattformen sind Diskursräume. Die Aufgabe politischer Medienbildung ist es daher auch, gemeinsam mit den Zielgruppen sachliche und differenzierte Diskurs- und Argumentationsstrategien für die Online-Diskussion zu entwickeln und einzuüben. Ein möglicher (kreativ und spielerisch zu gestaltender) methodischer Ansatz ist dabei, alternative und emanzipatorische Gegenentwürfe zu entwerfen, die dominante gesellschaftliche Narrative dekonstruieren und erweitern. In der Vermittlung ist jedoch auch das Sprechen darüber wichtig, wann Grenzen gesetzt werden können oder sollen. So ist es durchaus legitim, Diskussionen zu beenden, wenn Grundrechte in Frage gestellt werden oder kein konstruktiver Dialog möglich ist. Es sollte ein Austausch darüber stattfinden, welche Potenziale Gegenrede auf TikTok bietet (bspw. das Sichtbarmachen anderer Haltung in Sinne eines demokratischen Diskurses) und was aber auch dagegen sprechen kann bzw. welche anderen Diskursräume es gibt.
Pädagogische Ansätze und Kontexte
5. Partizipative, lebenswelt- und gestaltungsorientierte Bildung
Als pädagogische Ansätze für eine politische Medienbildung im Kontext sich wandelnder Demokratien eignen sich vor allem eigene Medienproduktionen, niedrigschwellige Einstiege und Peer-to-Peer-Lernen. Durch das aktive Gestalten von medialen Inhalten, die demokratische und emanzipatorische Werte vermitteln, kann eine Beteiligung an gesellschaftlichen Diskursen gefördert werden. Niedrigschwellig sind dabei vor allem vertraute Formate und Ästhetiken aus den Lebenswelten der Lernenden. Mit der Etablierung von Konzepten und Methoden, in denen gemeinsam an Ideen und Inhalten gearbeitet wird, kann eine gegenseitigen Weitergabe von Wissen und Erfahrungen gelingen.
6. Einbettung in formale, non-formale und informelle Bildungskontexte
Angebote der politischen Medienbildung mit dem Fokus auf Antifeminismus auf TikTok sollten aufgrund der hohen gesellschaftlichen Brisanz in allen Bildungskontexten implementiert werden. Es gilt daher, Bildungsmaterialien und Konzepte so zu gestalten, dass sie etwa durch eine modulare Struktur flexibel in verschiedenen Settings (bspw. Schule, Jugendarbeit, Hochschule) einsetzbar sind. Um der Komplexität des Phänomens gerecht zu werden, sind interdisziplinäre Perspektiven von Nöten, die etwa Medienbildung mit politischer Bildung, Geschlechterreflexion und anderen gesellschaftspolitisch relevanten Feldern verknüpfen. Hierbei eignet sich insbesondere das Format der Projektarbeit, was jedoch nicht als reine Kurzintervention zu denken ist. Insbesondere Langzeitformate, die eine tiefere Auseinandersetzung ermöglichen, Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte und kontinuierliche Bezugspersonen für junge Menschen tragen zur nachhaltigen Bildungspraxis bei.
Professionelle Haltung
7. Positionierung und Grenzsetzung
Für Pädagog*innen, Bildner*innen, Lehrende und Bezugspersonen ist die Entwicklung einer eigenen professionellen und klar demokratischen Haltung zentral. Diese umfasst die Positionierung gegen menschenfeindliche Äußerungen – ohne zu bevormunden oder zu moralisieren. Sie beinhaltet eine differenzierte und nuancierte Betrachtung antifeministischer Phänomene und die Vermeidung von Pauschalisierungen und vorschnellen Urteilen. Nicht zuletzt geht es um Authentizität und Transparenz. So bedarf es der Refl exion und Sichtbarmachung der persönlichen Position im gesellschaftlichen Gefüge.
8. Raum geben für Emotionen
Es müssen Räume geschaffen werden, in denen einerseits emotionale Reaktionen auf problematische und belastende Social-Media-Inhalte thematisiert werden können, und in denen andererseits das Sprechen über Ungerechtigkeitsgefühle und -erfahrungen im Alltag der Lernenden ermöglicht wird. In der feinfühligen Wahrnehmung und Anerkennung von erfahrenen Ungerechtigkeiten aller Lernenden aufgrund von Geschlechtszuschreibungen, lässt sich pädagogisch eine Brücke schlagen zum Sprechen über antifeministische Entwicklungen und die Diskriminierung von Frauen und LQBTQIA+. Der Zeitbedarf für diese Prozesse kann je nach Gruppe stark variieren und sollte nicht unterschätzt werden. Im Sinne von Selbstfürsorge und professioneller Unterstützung, müssen Strategien zum Umgang mit eigenen und fremden emotionalen Reaktionen entwickelt werden – die ggf. auch in der Suche nach externer Hilfe bestehen.
Beteiligung in Demokratien im Wandel
9. Utopiearbeit und Aufzeigen von Alternativen für demokratische digitale Räume
Politische Medienbildung wirkt als demokratische Beteiligungsarbeit. Antifeminismus auf TikTok ist an dieser Stelle als Beispiel für ein größeres Demokratieproblem im Digitalen zu verstehen. So gilt es, in medienpädagogischen Angeboten den Lernenden zunächst aufzuzeigen, dass gegenwärtige gesellschaftliche Prozesse und Bewegungen nicht alternativlos sind und von ihnen mitgestaltet werden können. Einen pädagogischen Ansatz hierfür bildet die Utopiearbeit, durch die eine gemeinsame Entwicklung von Visionen für eine gerechtere digitale Gesellschaft gefördert werden kann. Ein wichtiger Hebel besteht zudem in der Thematisierung von Möglichkeiten partizipativer Technikgestaltung. Vor dem Hintergrund, dass Plattformen wie TikTok als politische Akteure agieren und dabei eigenen Regeln und Interessen folgen, ist es Aufgabe der politischen Medienbildung, Lernenden die Chancen gemeinwohlorientierter digitaler Infrastrukturen erlebbar zu machen.
10. Sensibilisierung für politische Handlungsmöglichkeiten
Demokratien im Wandel bieten und erfordern Beteiligung, um Handlungsmacht im demokratischen System auszuüben. Hierfür gilt es, die Lernenden im Rahmen politischer Medienbildung zu sensibilisieren. Politische Handlungsmöglichkeiten lassen sich dabei im Digitalen auf verschiedenen Ebenen lokalisieren und mit den Lernenden besprechen: So kann es um die kritische Analyse und Produktion von Inhalten gehen, das Führen von Diskursen, die Positionierung in eigenen Peer-Groups, die Entlarvung gesellschaftlicher Akteur*innen und Ihrer Codes und Strategien, das Verstehen und Nutzen von Plattformmechanismen bis hin zur politischen Forderung nach Regulierung und Moderation digitaler Räume im Kontext privatwirtschaftlicher Logiken und dem Gestalten gemeinwohlorientierter digitaler Räume. Politische Medienbildung muss ihrer gesellschaftlichen Verantwortung insofern gerecht werden, als dass sie Brücken zwischen individueller Kompetenzvermittlung und gesellschaftlicher Transformation schlägt, indem sie zivilgesellschaftliche Akteur*innen in der Auseinandersetzung mit plattformvermittelter Menschenfeindlichkeit stärkt.